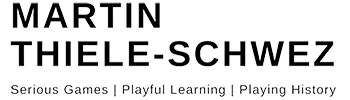Filmanalyse Paradise Now
„Allein von der Vorstellung vom Paradies hab’ ich schon mehr, als vom täglichen Leben in dieser Hölle hier.“
Paradise Now erzählt die Geschichte zweier junger Männer, von Saïd und seinem Freund Khaled, die im palästinensischen Autonomiegebiet, dem Westjordanland leben und gleich zu Beginn des Films für die Durchführung eines Selbstmordanschlages in Tel-Aviv ausgewählt werden.
Da die beiden keine Pässe besitzen, was ihnen die Ausreise aus der Stadt Nablus nahezu unmöglich macht, bleiben sie und somit der Zuschauer fast durch den gesamten Film räumlich dort gefangen. Obgleich in den vollen 90 Minuten nicht ansatzweise das Abfeuern auch nur einer Kugel oder das Explodieren einer Bombe gezeigt wird, fühlt der Zuschauer ununterbrochen eine gefährliche Spannung und ein inneres Unbehagen, welches sich stets in der Mimik der Darsteller widerspiegelt.
Paradise Now beginnt mit der Einreise Suhas ins Westjordanland. Die Tochter eines heroisierten Selbstmordattentäters und daher umso mehr Verfechterin des friedfertigen Widerstandes ist gezwungen, sich am Checkpoint den stummen Provokationen eines Grenzsoldaten auszusetzen. In der Kameraführung, die sich durchgängig ruhig und geradlinig zeigt, oft sogar nur statisch Bilder einfängt, werden bewusst inhaltliche Elemente zur umfassenden Charakterisierung einer Situation in den Hintergrund gerückt. So fällt in dieser Grenzerszene dem Zuschauer im letzten Moment des Kameraschwenks ins Auge, dass ein israelischer Soldat eine Waffe auf Suha richtet, was gleich zu Beginn die Asymmetrie des Nahost-Konflikts thematisiert. All das jedoch ist in ein warmes Licht getaucht, was konträr zur Gewalt selbst wirkt und aus der Sicht Saïds die Liebe und Verbundenheit zu seinem Palästina ausdrückt. Die Sicht Saïds ist es nämlich, in die der Zuschauer häufiger Versetzt wird. Dies geschieht indem er dem Protagonisten visuell und hiermit emotional nahe gestellt wird, aber auch indem er durch point of views, mit den Augen Saïd in dessen Welt blickt.
Häuserruinen, Drahtzäune und die dauerhafte Überwachung und Präsenz der bewaffneten Israelis bilden mehr als eine bloße Kulisse, sondern als Antagonist zu Saïd den versinnbildlichten Kontrapunkt im Film. Die stetige Gewalteinwirkung Israels auf die palästinensischen Gebiete und die Charaktere im Film wird allgegenwärtig.
Im weiteren Verlauf begegnen den Hauptrollen und somit auch dem Zuschauer Typen des Alltags wie Taxifahrer, Laden- oder Restaurantbesitzer, die einen gesellschaftlichen Querschnitt darstellen und in ihrer szenischen Anlegung ein Bild der elenden Resignation zeichnen. Suha, zwar arabischer Herkunft, aber nicht in Palästina lebend, deklamiert gegenüber einem Taxifahrer, dass es bald aufwärts gehe, woraufhin dieser nur folgert: „Sie sind wohl nicht von hier?“ Dieser Gesamteindruck der Gesellschaft löst ein mit-leiden auf Zuschauerseite aus.
Darüber hinaus hat der Zuschauer sofort Teil am Leben Saïds und Khaleds, was eine unmittelbare Identifikation mit den beiden Attentätern nach sich zieht. Regisseur Hany Abu-Assad sorgt allerdings dafür, dass es nicht möglich ist, die beiden Palästinenser nur als die Attentäter wahrzunehmen, schlichtweg aus dem Grund, dass sie von Beginn an in ihren alltäglichen und nicht im geringsten fanatischen Lebenssituationen gezeigt werden. So lernt der Zuseher die beiden auf ihrem Arbeitsplatz, einer Werkstatt, kennen, nimmt an gemeinsamen Gesprächen beim Tee teil und begleitet sie in Moraldiskussionen im Imbiss oder innerhalb ihrer Familie. Auch das Aufkeimen einer möglichen Liebesgeschichte zwischen Saïd und Suha, personalisiert den Protagonisten zunächst als vollkommen redlichen Mann.
In diesen trüben aber bei weitem nicht fiktiven Alltagszustand schlägt nun, für Saïd und den Zuschauer überraschend, die Ernennung zum Selbstmordattentäter. Die Situation, in welcher Saïd diese Aufgabe angetragen bekommt, ist bewusst beiläufig und still inszeniert, so dass sie als eine umso heftigere Zäsur begriffen wird. Der Anschlag, der gezielt als Racheakt gegen einen vorangegangenen Angriff Israels ausgewiesen wird, wurde von einer fiktiven und namenlosen Untergrundorganisation geplant und soll bereits am darauf folgenden Tag durchgeführt werden. Das Ziel: Als lebende Bombe möglichst viele Israelis in den Tod reißen, um die Welt aufzurütteln und ein Zeichen gegen die Besatzung zu setzen. Was, in diese Worte gepackt, wie eine Schlagzeile wirkt, wird in Paradise Now vollkommen ruhig und sachlich erzählt. Nur das nötigste wird gesprochen und die Räume sind in beängstigendes Schweigen gehüllt. Wie wenig solche Handlungen also aus brennender Rage, denn eher aus Verzweiflung entstehen wird hierdurch verdeutlicht. Trotzdem wird die Planung mit sachlicher Akribie durchgeführt.
Spätestens an dieser Stelle findet sich der neutrale Zuschauer in einer eindeutigen Dilemmasituation. Längst ist ihm ein Unbehagen durch die Unterdrückung Israels gegenwärtig und längst sind Saïd und sein Kollege Khaled seine Identifikationspersonen und trotzdem sagen seine Moralvorstellungen nein zum geplanten Mord als Auflehnung gegen die Unfreiheit Palästinas. Eine Psychologisierung des Zuschauers erfolgt demnach durch das Hineinversetzen in die Protagonisten.
Ist ein solcher Kunstgriff moralisch überhaupt zulässig? Sollte man trotz aller Grausamkeit ein Verständnis für Massenmörder haben? Ihre Taten nachvollziehen oder gar legitimieren? Um hierauf eine Antwort geben zu können, muss jedoch erst einmal eine andere Frage gestellt werden. Was bestimmt unser zeitaktuelles Denken? Das Höchstmaß an Informationen über den Nahost-Konflikt wird uns über die üblichen Massenmedien zugetragen, allen voran den Nachrichten im Fernsehen bzw. den News im TV. Zweifelsfrei sind diese notwendig und unabdingbar, trotz allem wird immer deutlicher, in welchem Maße Nachrichten auf immer stärkere Bilder, Gewalt und Kriegsdarstellung aus Nahost Wert legen. Hintergründe des eigentlichen Konflikts geraten hierbei oftmals ins Hintertreffen. Diese Hinwendung zur schnellen, packenden News muss im medienhistorischen Kontext begriffen werden, um das Anstreben von Paradise Now nachzuvollziehen.
Formal wendet sich der Film eben gegen eine überspitzt dramatisierte Darstellung. Lange Einstellungen, langsame Schnitte, eine ruhige Kameraführung und häufige Nahen sorgen sowohl visuell als auch ideell dafür, immer nah an den Menschen zu sein, über die der Film spricht – Saïd und Khaled, die Attentätern. Selbiges geschieht auch auf inhaltlicher Ebene. Hier blicken wir nicht auf die nachrichtenhafte Front, des Konflikts, sondern er wird uns von der anderen Seite, mit seiner Ursächlichkeit beleuchtet. Paradise Now wirft keinen Blick auf die Symptome sondern auf die Wurzeln der Problematik Nahost.
Den Auftrag anzunehmen ist für die Freunde zweifellose Ehrensache – „so Gott will“. Nachdem sie den letzten Tag mit ihrer Familie verbringen, Saïd noch ein nächtliches Gespräch mit Suha führt und ihr die Frage nach einem Wiedersehen ebenso mit „so Gott will“, beantwortet, beginnen die Vorbereitungen. Ein Abschiedsvideo wird gedreht, in dem erneut das menschlich-liebevolle der Hauptrollen mit dem nachdrücklichen kriegerischen Aufbegehren gegen die Tyrannei in Einklang gebracht wird. Eine Montage aus Bildern der Vorbereitung folgt, die trotz ihrer fortwährenden Ruhe ein Höchstmaß an Energie erreicht. Begründet liegt dies darin, dass in Kamerafahrten das dynamische Treiben der zahlreichen Helfer eingefangen wird, welche alle in höchster Spannung und Konzentration dargestellt werden. Haare und Bart werden gestutzt, der Körper gereinigt, die Zünder gebastelt und am Körper befestigt, der edle Anzug angekleidet und das buchstäblich letzte Abendmahl, wie auch bei Da Vinci, mit den 12 Jüngern eingenommen. Trotz des eindeutig christlichen Motivs mit welchem Hany Abu-Assad spielt, sitz am Platze Jesus` Saïd – der Erlöser. Auditiv liegt über diesen Bildern das Gebet, welches für die beiden „Gotteskrieger“ gesprochen wird. All das geschieht mit der betont zurückgenommenen Sachlichkeit, die der Film stetig durchhält und somit den Zuseher umso mehr berührt. Intensiviert wird dies durch das Gefühl der direkten Teilnahme des Zuschauers, was ihn wiederum in nahezu komplizenhafte Verantwortung zieht.
Gleich nach offiziellem Beginn der Aktion geht etwas schief. Die Wege von Saïd und Khaled trennen sich ungewollt und der Protagonist irrt allein durch das Westjordanland, begleitet von dem Gedanken, den der Zuschauer mit ihm teilt, ob dies der richtige Weg ist. Gerade weil Saïd auffallend wenig spricht, schafft der Film von Hany Abu-Assad viel Platz für den Zuschauer, Gedanken selbst zu konstituieren oder mit zu vollziehen. Hierzu gehören gewiss ebenso seine Ängste und Skrupel. Filmästhetisch tragen erneut die nahen Einstellungen und teilweise point of views zur weiteren Verbindung zwischen Zuseher und Hauptrolle bei.
Wie fragil das gebaute Kartenhaus des geplanten Anschlags ist, ist dem Zuschauer längst deutlich. Khaled gerät auf der Suche nach seinem Freund immer deutlicher, nicht zuletzt durch die Einflussnahme Suhas, in Zweifel über die Richtigkeit des Vorhabens. Saïd hingegen schärft sich selbst immer stärker die Richtigkeit des Projektes ein. Visuell ist bemerkenswert, dass beide auf ihrer Suche das Bild in unterschiedlicher Richtung durchlaufen. Khaled erfährt ein geistiges Vorankommen in der Bewegung von links nach rechts, Saïd geht dem auf seiner Suche entgegen. Mit dem Blick in die Kamera teilt er dem Zuschauer mit, dass es Gottes Wille ist und keine andere Lösung besteht. Seine zitternden Lippen und die Schweißperlen auf der Stirn sprechen allerdings eine andere Sprache. Doch auch die Tatsache, dass Saïd, Sohn eines Kollaborateurs, stets glaubt, die Ehre seiner Familie wieder herstellen zu müssen, lässt ihm keine andere Wahl. Der Zuschauer muss machtlos mit ansehen, wie Saïd sich selbst, seine Familie und einen Bus voller Israelis ins Verderben stürzt.
Die Kritik an Paradise Now, dass in dem Film Selbstmordanschläge legitimiert werden, ist deutlich zurückzuweisen. Denn die Charaktere entwickeln sich und unterschiedliche Wege werden aufgewiesen. Das letztlich der angekündigte Weg bis zum Ende gegangen wird, trägt umso mehr zum emotionalen Teilhaben des Zuschauers bei. Saïd bittet das Projekt erneut durchführen zu dürfen, sorgt mit einer Finte dafür, dass Khaled aussteigt und sprengt sich selbst in Tel-Aviv in die Luft. Die In diesen letzten Entscheidungen ist ein weiteres moralisches Dilemma verborgen. Saïd muss entscheiden zwischen dem Leben und dem Widerstand gegen die Besatzung. Einen Mittelweg sucht er darin, seinen ohnedies zweifelnden Freund zu retten, die Tat selbst jedoch durchzuführen.
Der Film endet auf Saïds glasigen Augen. Zu hören ist nichts. Das Bild wird Weiß – die Farbe der Trauer im Islam – und der Film ist vorüber. Selbst in diesem Ende wird konsequent auf Musik verzichtet und der Zuschauer bleibt mit sich selbst und seiner Verantwortung zurück. Gerade Saïds finaler Monolog, in dem er für sich den Grund des Attentats manifestiert, ist Schlüssel zum Verständnis. Lässt sich der Zuschauer hierauf ein, öffnen sich ihm neue Perspektiven, die weit über die Grenze der politischen correctness hinausgehen. Allerdings begründen sie die nicht enden wollende Verkettungen von Unmenschlichkeiten höchsten Maßes.
Darüber hinaus wirft der Film die Frage nach der Opfer-Täter Konstellation auf, die erfahrungsgemäß gerade in Deutschland gescheut wird. In besagtem Monolog fragt Saïd: „Was bin ich? Was bleibt mir übrig, als Opfer und Opfernder, Unterdrückter und Mörder zu sein.“ Spätestens an dieser Stelle richtet sich die Frage aber nicht mehr an ihn selbst, sondern an die Zuschauer. Was bleibt ihnen übrig? Wie müssen sie sich im Film positionieren? Der Versuch, eine Identifikationsfigur für den Zuschauer in Saïd zu schaffen und ihn somit gewissermaßen zum gebrochenen Helden zu machen, ist ein vollkommen legitimes und achtbares Mittel, welches Hany Abu-Assad umsetzte. Allerdings nicht, um eine Legitimierung der Selbstmordattentate zu finden, sondern überhaupt dem Zuschauer den Blick in den Konflikt zu ermöglichen. Gerade deshalb spricht Saïd doch gesellschaftsreflexiv aus der Leinwand nach draußen, zu der Welt. Als wäre es an jeden Menschen flehentlich gerichtet meint der Protagonist: „Die Welt beobachtet es, aber bleibt gleichgültig, feige, verlogen. Du fühlst, du stehst dem Unterdrücker so alleine und wehrlos gegenüber. Du suchst nach Lösungen das ohne euch zu beenden.“
Dies macht Paradise Now zu mehr als einem gewöhnlichen Film. Auch zu mehr als einem interessanten Film mit ausgeklügeltem Heldenschema. Sondern es macht ihn zum einen zu einem aktuell überaus relevanten und gesellschaftlich bedeutsamen Medienerzeugnis und zum zweiten zu einem hoffenden Aufschrei an die Weltbevölkerung. Um den Konflikt im Nahost verstehen zu können, sind genau solche Botschaften an die Welt unerlässlich. Auch wenn der Stoff zweifelsfrei heikel ist, darf man sich ihm gegenüber nicht verschließen. Kais Nashef, Hauptdarsteller des Saïd, meint diesbezüglich zu Recht: „Israelis und Palästinenser müssen diesen Film sehen. Sie sind so übersättigt mit Nachrichten und politischen Ideologien, die mit der Wirklichkeit nichts zu tun haben. Sie haben kein Gefühl mehr dafür.“
Mit äußerster Sensibilität und dem trotzdem bestehenden Wissen hiermit moralische Grenzen zu übertreten, versucht Paradise Now zumindest einen gewissen Teil zur Rückgewinnung dieses Gefühls zu leisten.